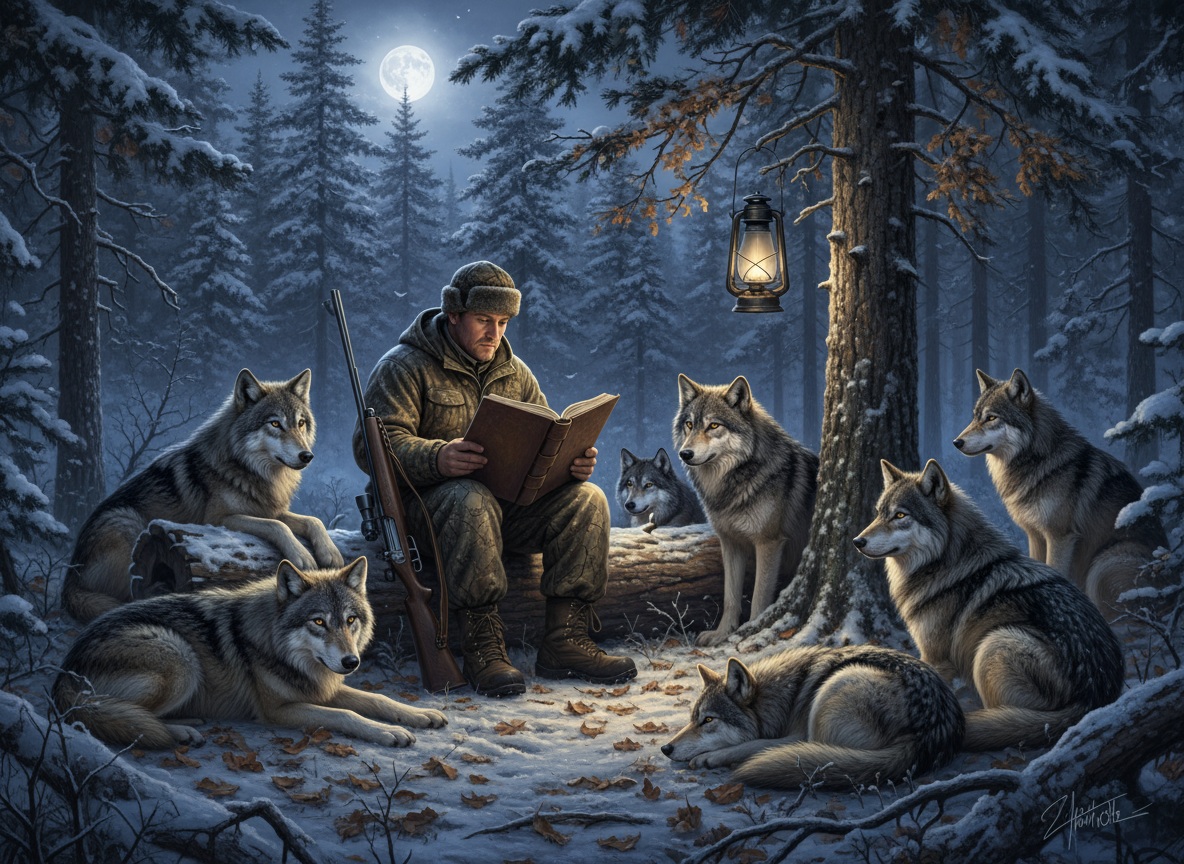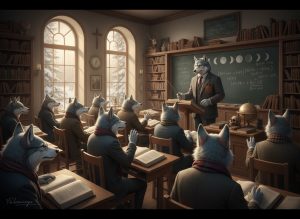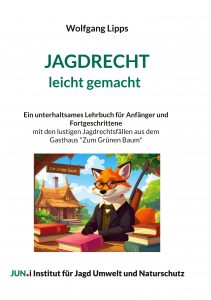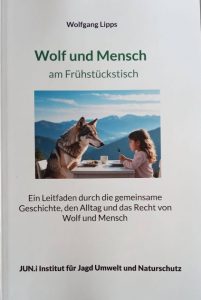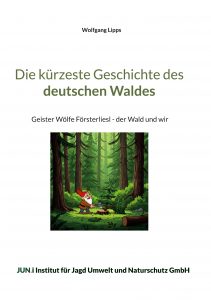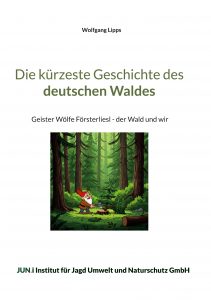Die Überschrift nimmt nicht die Herren Putin, Trump, Musk, Orban oder Kim Jong-un ins Visier, sondern den europäischen Wolf, Canis lupus lupus. Vor ca. 150 Jahren in Deutschland ausgerottet ist er seit den 1980er Jahren, seit denen er unter Naturschutz steht, wieder eingewandert und vermehrt sich kräftig. Er ist ein großes intelligentes und gefährliches Raubtier und schafft deshalb in einer dicht besiedelten Kulturlandschaft wie der Bundesrepublik Deutschland zunehmend Probleme – über deren Lösung „wogt und wallt der Hader“.
Also muss jetzt in 2025 endlich ein vernünftiges Wolfsmanagement her, und zwar bundesweit.
Aber wie sieht´s damit aus?
Wölfe und Menschen
Wölfe leben meist in Rudeln, die aus Familienverbänden entstehen, und das in Territorien (Revieren) von ca. 30.000 ha. Sie sind gute Jäger, die auch größere und wehrhafte Tiere wie Rinder erbeuten können, wobei sie wie alle Raubtiere stets vorsichtig sind. Menschen gehören nicht zu ihrem Beutespektrum, aber eine natürliche Furcht vor dem Menschen haben sie auch nicht. Deshalb können sie z. B. Kindern schon mal gefährlich werden – Volksmund auf dem Lande: “Erst die Rinder dann die Kinder“.
Da Wölfe in besiedelten Gebieten naturgemäß überwiegend nachtaktiv sind, ist eine Bestandszählung schwierig und vor allem ungenau. Offiziell leben gegenwärtig 1601 Wölfe in Deutschland (209 bestätigte Rudel, 46 Paare und 19 territoriale Einzeltiere) – diese Zahl ist mit Sicherheit falsch, wie das Bundesamt für Naturschutz selbst zugibt. Der Landesjagdverband Brandenburg sieht schon für sein Bundesland mehr als 1000 Wölfe, und auch diese Zahl steigt ständig. Der Chef der Jagdzeitung „Der Überläufer“ geht nachvollziehbar von gegenwärtig wahrscheinlich rund 4000 Wölfen in Deutschland aus.
Wölfe haben bundesweit bereits im Jahr 2022 nahezu 6000 Nutztiere getötet – und zwar nach der offiziellen Statistik, die schon deshalb erheblich zu niedrig ist, weil sie nur die Fälle erfasst, in denen Entschädigung geleistet wurde. Nach Feststellung der EU beliefen sich im Jahre 2022 diese Verluste u. a. auf 200 Hunde, 12.000 Rinder und über 3.600 Pferde. „Da Weidetiere relativ leicht zu erbeuten sind – sie können nicht weglaufen – spezialisieren sich immer wieder einzelne Wölfe oder Rudel auf diese leichte Beute, wobei der Wolf bisher jeden Schutzzaun überwunden hat.“
Und Brandenburg ist Wolfsland Nr. 1: Nach Angaben des Landesumweltamtes wurden noch nie zuvor so viele Rudel und Welpen gezählt wie im Herbst 2024. Mit (mindestens – wahrscheinlich mehr) 58 Rudeln ist die Wolfspopulation in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich gewachsen.
Wölfe in Deutschland werden von einer Reihe von Institutionen beobachtet, ein wenig mit ziemlich unkoordiniertem Monitoring verfolgt, und so gut wie überhaupt nicht reguliert. Zuständig sind auf offizieller Seite das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und dessen Dokumentations- und Beratungsstelle zum Thema Wolf (DBBW) sowie das Bundesamt für Naturschutz (BfN). Aktiv dabei sind u. a. das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildforschung sowie das Senckenberg-Institut und ein selbsternanntes „Experten-Gremium“ namens „LUPUS Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland“. Ferner mischen die Umweltverbände wie BUND und NABU natürlich kräftig mit, meist auf Seiten der „Wolfsfreunde“ – gern auch als „Wolfskuschler“ verschrien – und letztlich sind die Länderministerien für Umwelt oder Landwirtschaft ebenso beteiligt wie letztlich die für Jagdrecht und Jagdpolitik Zuständigen. Dieser Dschungel von mehr oder minder kompetenten Institutionen hat bisher dazu geführt, dass sowohl in der EU als auch in der Bundesrepublik Deutschland von einer vernünftigen Wolfspolitik beim besten Willen nicht die Rede sein kann.
Und das, obwohl Deutschland die wahrscheinlich höchste Wolfsdichte aller zivilisierten Länder der Welt hat, und im Vergleich zu Wolfsländern wie Polen oder Schweden auch die höchste Zahl an Wölfen. Aber die wahren Zahlen werden inzwischen schon absichtlich verschleiert – die „Wolfsfreunde“, mit Hilfe des Senckenberg-Instituts, deklarieren gern Wolfsrisse zu Attacken von wildernden Hunden oder, Gipfel des Abstrusen, auch schon mal reißenden Füchsen um, nur damit es „jedenfalls kein Wolf gewesen ist“ – weil „nicht sein kann was nicht sein darf“!
Inzwischen vermehren sich die Wölfe munter weiter, die Schäden steigen, immer mehr Schaf- und Ziegenzüchter und Schäfer geben auf, und die Besorgnis um Hunde und Kinder nimmt zu.
Die Rechtslage
Der Wolf ist streng und mehrfach geschützt, und das seit nunmehr vielen Jahren, weswegen er auch nicht bejagt werden darf. Schon im Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) vom 3. März 1973 ist der Wolf in Anhang II als gefährdete Tierart aufgeführt – warum, ist nicht ganz verständlich. Die Berner Konvention von 1979, von der EU übernommen, enthält den Wolf auch in Anhang II, dessen streng geschützte Tiere weder gestört noch gefangen noch getötet noch gehandelt werden dürfen. In Deutschland sind die europäischen Regelungen in das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) übernommen worden, das aber – wie so oft in Deutschland – den Schutz noch übertreibt. Danach hat der Wolf den höchsten Schutzstatus nach § 7 (2) Nr. 13 und 14 B. Er unterliegt nach § 44 Zugriffs-, Stör-, Besitz und Vermarktungsverboten. Nach diesem Naturschutzrecht – § 45 (7) BNatSchG – sind Ausnahmen vom Schutz der Wölfe nur im Einzelfall, z. B zur Abwehr erheblicher Schäden und zum Umgang mit gefährlichen Tieren erlaubt.
Nach Art. 12 Abs. 1 FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU zur Erhaltung von Tieren und ihrer Lebensräume) sind die Länder verpflichtet, den Wolf vor Störungen aller Art zu schützen; diesen Schutz bieten deshalb die §§ 39 Abs. 1 Nr. 1 und 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die es verbieten, wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder in bestimmten Lebensphasen (Fortpflanzungs- Überwinterungs- oder Wanderungszeiten) erheblich zu stören.
Verstöße sind regelmäßig ordnungswidrig gem. § 69, bei Vorsatz aber eine Straftat gem. § 71 BNatSchG (und auch nach § 17 TierSchG). Ein Einzelabschuss eines Wolfs nur im Zusammenwirken mit den Naturschutzbehörden – also eigentlich oft völlig ineffektiv! – ist nur nach Art. 16 Abs. 1 FFH-Richtlinie zulässig, wenn Menschen, Vieh oder Haustiere gefährdet sind und andere Maßnahmen keine Abhilfe versprechen. Das gilt auch für Hybriden.
Und wann immer eine Behörde einmal ausnahmsweise die Erlegung eines Wolfs erlaubt, wird das von den sogleich von Wolfsfreunden aller Art angerufenen Gerichten wieder verboten, zum Teil mit höchst merkwürdigen Begründungen.
Das wiederum hängt in aller Regel damit zusammen, dass Art. 16 der FFH-Richtlinie die Erlegung eines Wolfs aus besonderen Gründen nur dann erlaubt, wenn „die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen“ – d. h. wenn durch einen Abschuss nicht der Erhalt der Art in Frage gestellt wird. Das aber behaupten die „Wolfsfreunde“ durchweg und pausenlos und ständig – ohne Rücksicht darauf, dass der Wolf in Deutschland seinen „günstigen Erhaltungszustand“ längst erreicht hat. Dazu würden nämlich schon 250 ausgewachsene Individuen genügen, und die muntere Vermehrung der Wölfe trotz Straßenverkehr und heimlicher Tötung beweist, wie gut es unseren Wölfen inzwischen geht.
Wie sieht es 2025 aus?
Einiges ist schon geschehen – der Europarat hat den Schutzstatus des Wolfes am 3. Dezember herabgesetzt. Aber das allein reicht natürlich nicht aus; die FFH-RL müsste den Wolf zunächst aus Anhang IV in Anhang V (also von „streng geschützt“ in nur „geschützt“ – auch nicht so doll, aber besser) überführen. Das wäre leicht, wenn die hierfür notwendige Einstimmigkeit der Mitgliedsstaaten – Deutschland hat just seine Behinderungshaltung aufgegeben – nicht ausgerechnet von Irland unterlaufen würde – einem Land, in dem überhaupt keine Wölfe vorkommen, aber eine EU-weit konkurrierende Milchwirtschaft zu Hause ist! „Ein Schelm der Böses dabei denkt!“ (Lars Eric Broch im „Überläufer“ 01/2025).
Da muss also erst einmal die EU endlich tätig werden. Aber darauf sollte nicht gewartet werden, sondern hierzulande gehandelt.
Bundesnaturschutzgesetz und Bundesjagdgesetz.
Beide Rechtsgebiete gehören nach der Föderalismusreform nicht mehr zu den Rahmengesetzen, sondern zur konkurrierenden Gesetzgebung, wobei der Artenschutz selbst beim Bund verblieben ist. Die Jagdbarkeit von Tieren durch Aufnahme in den Katalog der jagdbaren Tierarten als „Wild“ aber obliegt den abweichenden Gesetzgebungsbefugnissen der Länder.
Als ersten Schritt noch vor einer EU-Regelung könnte also der Bundesgesetzgeber das BNatSchG novellieren und dabei zumindest so straffen, dass es sich mit Art. 16 der FFH-RL deckt. Zugleich sollte der Wolf als weitere Wildart, die dem Jagdrecht unterliegt, ins BJagdG aufgenommen werden. Das gilt dann bundesweit, solange und soweit die Länder nicht von ihrer Gesetzgebungsbefugnis Gebrauch machen.
Landesjagdgesetze
Im Artenschutz geht Bundesrecht vor, aber die Jagdbarkeit von Tieren im Landesjagdrecht können die Länder selbst entscheiden. Sie können also den Wolf dem Jagdrecht unterstellen und in ihre Landesjagdgesetze aufnehmen. Würde der Wolf ins Jagdrecht übernommen entfiele der strenge Schutz der deutschen BArtSchV, aber der Schutz nach Anhang IV der FFH-RL bleibt. Jagdrechtliche Aneignungsrechte gehen den naturschutzrechtlichen Besitzverboten und artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten vor (str.). Fraglich ist, ob eine Überstellung ins Jagdrecht gegen EU-R Art. 12 FFH-RL verstoßen würde. Ausnahmen gehen wohl, aber bislang nur nach Art. 16.
Die Landesjagdgesetze von Sachsen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hessen haben den Wolf schon aufgenommen, aber nicht nur ohne Bejagung, sondern auch, bislang noch richtiger Weise, unter Ausschluß nahezu jeglicher Sondergenehmigungen für Abschüsse. Das muss überarbeitet und auch europarechtlich berichtigt werden.
Der „günstige Erhaltungszustand“.
Jedenfalls aber sollten alle Landesjagdgesetze den Wolf aufnehmen – der Wolf gehört ins Jagdrecht und muss letztlich aktiv bewirtschaftet werden. Dabei sollte der längst gegebene „günstige Erhaltungszustand“ gesetzlich festgeschrieben werden. Damit entstünde eine Bindung für das Verwaltungsermessen, das für eine Erlegung eines Wolfs anzuwenden ist, und es entstünde vor allem eine diesbezügliche Bindung der Gerichte, um schwer verständliche Urteile wie z. B. vom VG Koblenz oder dem OLG Celle in Zukunft zu vermeiden – vom höchst wünschenswerten Erkenntnisgewinn bei NABU, BUND, LUPUS und anderen ganz zu schweigen!
Und das liebe Geld.
Bund und Länder geben zunehmend mehr Geld aus für das Problem „Wolf“. Auch hier kann einiges geschehen. So benötigen die Verbände keine Steuermittel – als der Wolf auftauchte, gabs gleich mal mehr zahlende „Wolfsfreunde“ als Wölfe. Steuermittel für selbst ernannte Wolfsfreunde wie LUPUS sollten strenger kontrolliert werden. Dafür sollte das System der Entschädigungen für Wolfsrisse erheblich schneller, direkter, unbürokratischer und gerechter werden, und die Rissgutachten des Senckenberg-Instituts verdienen eine kritische Hinterfragung allemal. Das Monitoring sollte verbessert und bundesweit vernetzt werden – einige Bundesländer tun das bereits oder planen es jedenfalls. Und alle „Wolfsverordnungen“ gehören auf den Prüfstand.
Ausblick
Es kann einiges geschehen, und muss das auch! Aber der Weg ist steinig und voller Hindernisse und „Wolfskuschler“. Aber die Vorgänge in der EU zeigen, dass langsam, sicherlich auch unter dem Druck zunehmender Wolfsrisse einerseits und Forderungen Betroffener andererseits ein Umdenken einsetzt, schon länger auf dem Lande und immer mehr auch in den noch überwiegend wolfsfreundlichen, weil wolfsferneren, Städten.
Eine neue Bundesregierung wird wahrscheinlich weniger „verbotsgrün“ und, wenn überhaupt, mehr „Umweltgrün“, zudem pragmatischer sein. So ist zu hoffen, dass auch in die Welt der „Problemwölfe“ Bewegung kommt.
Denn „Wölfe gäb´s in großer Schar“ – wie schon der Dichter Christian Morgenstern festgestellt hat.
Ihr Dr. Wolfgang Lipps

Anhang vom 09. Januar 2025
Prof. em. Dr. Pfannenstiel hat zu dem obigen Blogpost eine sehr instruktive Ergänzung erstellt, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen:
Wolf in Deutschland
Prof. Dr. Hans-Dieter Pfannenstiel 9.01.2015
Die offiziellen Zahlen zum Wolf in Deutschland stellt die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (https://www.dbb-wolf.de/) zur Verfügung. Als Monitoringjahr bzw. Wolfsjahr gilt die Zeit vom 1. Mai bis 30. April. Diese Zeitspanne wurde ohne erkennbare biologische Begründung vermutlich ganz absichtlich gewählt, um das Wolfsjahr vom Jagdjahr zu unterscheiden. Die Zahlen der DBBW beruhen auf den Ergebnissen der Monitoringverfahren der Bundesländer. Es vergeht wegen der unterschiedlichen Monitoringverfahren und des langwierigen und komplizierten Meldewegs jeweils mindestens ein Jahr, bis die Zahlen für ein bestimmtes Wolfsjahr feststehen. Es handelt sich dabei um Mindestzahlen, da ganz sicher nicht jedes Wolfsindividuum auch gesehen wird. Im Monitoring werden auch nur Wölfe berücksichtigt, die ein Revier besetzt haben. Insbesondere die aus den Rudeln jedes Jahr abwandernden Jungwölfe werden nicht erfasst. Sie sind in der jährlichen Welpenzahl enthalten. Die Zusammensetzung der Rudel ändert sich im Jahreslauf. Neue Welpen kommen hinzu, ältere Welpen bzw. Jungwölfe wandern ab. Allgemein rechnet man in Jahresmittel mit 8 Wölfen je Rudel.
In folgender Aufstellung sind die offiziellen Zahlen der DBBW mit Stand vom 27.11.2024 aufgeführt:
- Wölfe in Deutschland 2023/24
- Rudel 209 x 8 = 1672
- Paare 46 x 2 = 92
- Einzeltiere 19
- Welpen 781
- Mindestzahl Wölfe in Deutschland 2564
- Wölfe in Brandenburg 2023/24
- Rudel 58 x 8 = 464
- Paare 8 x 2 = 16
- Einzeltiere 2
- Welpen 210
- Mindestzahl Wölfe in Brandenburg 700
Der Zuwachs von 2022/23 auf 2023/2024 ist deutlich unter den geschätzten 30-35% Jahreszuwachs. Allerdings muss man vermutlich damit rechnen, dass die Zahlen der DBBW für 2023/2024 noch nicht endgültig sind.
Immer wieder ist in der öffentlichen Diskussion die Rede von verschiedenen Wolfspopulationen in Europa oder gar in einzelnen deutschen Bundesländern. Die Frage, ob die deutschen Wölfe eine eigene Population darstellen oder als lokale Bestände betrachtet werden müssen, ist deshalb von Bedeutung, weil die FFH-Richtlinie stets von Populationen ausgeht. Man sollte annehmen, dass damit Populationen im Sinne der biologischen Definition gemeint sind.
Eine Population im biologischen Sinne ist eine Fortpflanzungsgemeinschaft. Sie besteht aus Angehörigen einer Art, die zeitlich-räumlich von anderen Artangehörigen isoliert sind. Nun ist seit langem bekannt, dass zwischen den Wolfsvorkommen in Europa Genaustausch besteht.
Lange Wanderungen einzelner Exemplare und die genetischen Folgen sind nachgewiesen. Zwar hat dieser Genaustausch keine demografischen Auswirkungen, zeigt aber doch, dass das Festhalten an verschiedenen europäischen Wolfspopulationen keine wissenschaftliche Basis hat. Die europäischen Wölfe gehören einer Population an, die sich vermutlich über ganz Nordeurasien erstreckt. Man kann bei den Wolfsbeständen europäischer Länder allenfalls von Subpopulationen sprechen. Die eurasische Population kann deshalb als Meta-Population bezeichnet werden.
In der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU geht es beim Artenschutz nicht um Einzelindividuen, sondern um Populationen, und Populationen sollen sich im günstigen Erhaltungszustand befinden. D. h., die Zahl der Individuen soll nicht geringer werden, sondern eher wachsen, und der Lebensraum soll sich möglichst eher erweitern. Beides ist übrigens in Europa gegeben. In der FFH-Richtlinie finden sich keinerlei Angaben, wie viele Individuen einer streng geschützten Art aus dem Anhang IV in einem bestimmten Gebiet vorhanden sein sollen, um vom günstigen Erhaltungszustand sprechen zu können. Die herumgeisternde Zahl von 1000 geschlechtsreifen Wolfsindividuen, sprich 500 Rudel (!), die für den günstigen Erhaltungszustand einer Wolfspopulation nötig seien, ist später für Huftiere postuliert worden und hat mit dem Wolf nicht das Geringste zu tun!
Es geht in der FFH-Richtlinie ausdrücklich nicht um lokale Bestände einer Art. Deshalb besteht der ideologische geprägte Wolfsschutz auf seiner Meinung, die deutschen Wölfe gehörten zu einer sog. Mitteleuropäischen Flachlandpopulation. Eine solche Population ist ein reines Fantasieprodukt. Dann wird argumentiert, diese „Population“ befinde sich noch nicht im günstigen Erhaltungszustand, weshalb der Wolf weiter den höchsten Schutz genießen müsse. In Deutschland hat diese absurde Argumentation dazu geführt, dass jedes einzelne Bundesland meint, sein Wolfsbestand sei eine eigene Population und müsse sich im günstigen Erhaltungszustand befinden. Leider scheinen manche Verwaltungsgerichte diese unsinnige Argumentation zu übernehmen, wenn es um Klagen gegen Wolfsabschüsse geht.
Die nordeurasische Wolfspopulation hat sich seit jeher im günstigen Erhaltungszustand befunden, obwohl Isegrim in vielen Ländern Europas und auch im asiatischen Teil Russlands scharf bejagt wurde (wird) und obwohl der Wolf in weiten Teilen Mitteleuropas jahrzehntelang ausgerottet war. Canis lupus ist nach wie vor eine der am weitesten verbreiteten Säugetier-Arten der Nordhalbkugel. Dass der Wolf Deutschland nach und nach wieder besiedelt, ist kein Verdienst des Naturschutzes und beruht auch nicht darauf, dass in unserem Land die heile Natur zurückgekehrt ist. Ausschlaggebend war der Totalschutz des Wolfes nach 1992. In der DDR wurden die immer wieder aus dem Osten zugewanderten Wölfe konsequent erlegt. Es bestand Konsens darüber, dass man den Wolf in der Kulturlandschaft nicht haben wollte.
Die Zahlen der DBBW zeigen übrigens auch deutlich, dass Wolfszahlen und Zahl der Risse von Weidetieren seit der Wiederbesiedlung parallel exponentiell angesteigen. Funktionierte der Weidetierschutz mit Zäunen und Hunden tatsächlich, dürfte sich die Zahl der Risse von Weidetieren nicht immer weiter erhöhen. Weidetierschutz ist also auf Dauer kein Allheilmittel, um das Zusammenleben von Mensch und Wolf in der Kulturlandschaft vernünftig zu gestalten. Das lässt sich sicher mit regulärer und kontrollierter Bejagung des Wolfs erreichen, wie es im Baltikum praktiziert wird. Obwohl dort im Jahresmittel 300 Wölfe erlegt werden, hat die EU den dortigen Wölfen ausdrücklich den günstigen Erhaltungszustand attestiert!
Leider wird es beim gegenwärtigen personellen Status in den zuständigen Ministerialbürokratien des Bundes und der Länder trotz des Europaratsbeschlusses zur Absenkung des Schutzstatus des Wolfs wohl noch Jahre dauern, bis auch in unserem Land der Wolf wie anderes Wild durch reguläre und kontrollierte Jagd an die Landeskultur angepasst werden kann. Derzeit muss sich die Landeskultur (Beweidung) an den Wolf anpassen, was für die Biodiversität des durch Beweidung geschaffenen Offenlandes unübersehbare negative Folgen haben wird.
* * *